Vor einiger Zeit entdeckte ich den Freiraum-Kompass® von Dr. Tony Hofmann. Allein der Name machte mich schon neugierig und interessiert, ihn auszuprobieren.
Da in der Schachtel auch ein Anleitungsheft darin war, habe ich erstmal für mich selbst damit gespielt und probiert. Später habe ich auch andere Erfahrungen mit diesem Tool machen können. Für den Focusing-Blog konnte ich auch einen kleinen Austausch mit dem Entwickler selbst führen.
Zum allgemeinen Verständnis möchte ich den Freiraum-Kompass® erst einmal vorstellen.
Der Freiraum-Kompass® ist ein Werkzeug für Selbstfocusing und begleitete Focusingprozesse. Es besteht aus einer Schachtel mit 15 Fragekarten in 5 unterschiedlichen Farben, einem Holzkompass und einer Anleitung.


Handhabung des Freiraum-Kompasses®
Das Kartenset besteht aus Karten in verschiedenen Farben, die jeweils einen Schwerpunkt haben, z.B. rot für Konfliktaspekte und einem kleinen Holzkompass.
Mit der Anfangskarte bestimme ich die Situation, mit der ich mich auseinandersetzen will, mit der Schlusskarte sichere ich die Schritte und Erkenntnisse aus dem Prozess.
Auf den anderen Karten stehen Impulse, Betrachtungsmöglichkeiten, Fragen, die man sich selbst stellen kann. Bei manchen Farben können Karten ausgewählt werden, bei anderen sind alle Karten zu bearbeiten. Das Zufallsprinzip durch das Drehen des Kompasses beeinflusst vor allem die Reihenfolge der Impulse.
Nun können Sie das kleine Zwiegespräch lesen, dass beim Austausch über den Freiraum-Kompass entstanden ist.
Bettina Markones: „Wie ist der Freiraum-Kompass® eigentlich entstanden?“
Tony Hofmann:
„Die Idee für den Freiraum-Kompass® entstand ursprünglich aus meinen intensiven Studien zum Prozessmodell von Gene Gendlin. Jahrelang habe ich mich mit dem Modell auseinandergesetzt, es in eigenen Worten zusammengefasst und Lernhilfen erarbeitet. Dabei wuchs der Wunsch in mir, das Wesentliche noch stärker zu verdichten und auf den Punkt zu bringen.
Um dies zu erreichen, entwickelte ich ein Tabellensystem mit fünf Spalten und fünf Zeilen. Die Zeilen bezogen sich auf Gendlins Basismodell (Prozessmodell Kapitel I-V), die Spalten auf das erweiterte Modell (Kapitel VI-VIII), es beinhaltet auch eigene Differenzierungen und Erweiterungen. Dieses tabellenartige ‚Spielfeld‘ stillte zunächst mein Bedürfnis, mit dem Modell experimentieren und von ihm aus weiterdenken zu können.
Gleichzeitig erkannte ich, dass dem theoretischen Konstrukt eine praktische Komponente hinzugefügt werden sollte. Meine Dissertation über experienzielle Kommunikation[1] schien hierfür als Ideengeber geeignet. Experienziell bedeutet: Man fühlt, was man sagt, man wartet darauf, dass die Worte kommen dürfen, man richtet sich am eigenen Erleben aus, wenn man spricht. Ziel war es also, ein ganzheitliches Spielzeug zu entwickeln, mit dem man die Entscheidungsfindung im Alltag stark vom eigenen Erleben (vom Felt Sense) leiten lassen kann. Ich erweiterte somit die bisherige Tabelle zu einem dreidimensionalen System (5x5x5). Die einzelnen Bestandteile wurden auf Spielkarten in Form von Fragen festgehalten. Mit Hilfe dieser Fragen wurde es möglich, eine Alltagssituation zu reflektieren.
Es gab nun also
- fünf Fragekärtchen, die dabei helfen, sich verschiedene Prozessqualitäten zu vergegenwärtigen („Was ist gestoppt?“ „Was entsteht von selbst?“ etc. – gelbe Kärtchen),
- fünf weitere, um verschiedene Prozessebenen zu unterscheiden, auf denen möglicherweise eine Paradoxie oder ein Konflikt aufscheint (Körper, Verhalten, kulturelle Räume und Vereinbarungen, Kreativität und die Sinn-Ebene – rote Kärtchen) und schließlich
- fünf Fragen, die das direkte (kommunikative) Handeln betreffen (blaue Kärtchen).
Ein erster Prototyp nach diesem Schema wurde mit verschiedenen Gruppen erprobt.
Die Kompassnadel fertigte ich in meiner Werkstatt mit dem Lasercutter an. Den entscheidenden Funken brachte meine Mutter beim Testen am Küchentisch ein, als sie die Kompassrose des Prototyps unbewusst zwischen ihren Fingern drehte - so kam ich auf die Idee, eine kleine Metallkugel zu integrieren, die den Kompass drehbar macht. Von einem Kollegen inspiriert durch seine Wanderungen durch den Spessart, sollte der Kompass und seine Verpackung zudem so gestaltet sein, dass er überall hin mitgenommen werden kann. Den KollegInnen vom ZKS-Verlag war klar: Das Ding muss in die Hosentasche passen.
Aus Rückmeldungen von KundInnen weiß ich, dass der Kompass auch für sehr tiefgründige Prozesse genutzt wird. Die längste Session, von der mir berichtet wurde, dauerte 5 Stunden. Sein Wesen ist jedoch die Leichtigkeit und die Kürze – es geht darum, die wenigen nächsten Schritte, die die Situation stimmig vorantragen, einfach, spielerisch und unkompliziert finden zu können. Ganz wie ein richtiger Kompass eben, der unterwegs dabei helfen kann, die Orientierung wieder zu erlangen.
Du hast ja schon einige Erfahrungen mit dem Freiraum-Kompass gemacht. Magst du da mal was erzählen?“
Bettina: „In einem Workshop hat jede/r einen ganzen Tag an seinem eigenen Projekt gearbeitet. Als Abschlussübung arbeiteten wir zu zweit mit dem Freiraumkompass. Der erste Schritt ist wie in einer herkömmlichen Focusingbegleitung: Ein Mensch fokussiert zu seinem Thema, der andere Mensch begleitet. Dann aber fügen wir einen weiteren Schritt ein. Zu dem, was der Fokussierende gefunden hat, nimmt der Begleiter sein eigenes Projekt dazu und verbindet das mit dem, was der Fokussierende gefunden hat. Klingt vielleicht erstmal schwierig, daher ein Beispiel.
Meine Partnerin möchte mit Erwachsenen persönliche Ziele untersuchen, ich will bei Kindern die Resilienz fördern. Klingt im ersten Moment, als wenn da wenig Gemeinsames ist.
Eine Frage aus dem Freiraumkompass (in knapper Form) heißt: Was ist schon da? Im ersten Moment kommt mir die Frage sehr simpel vor, schließlich weiß ich ja, was alles schon da ist und viel mehr interessiert mich ja, wie das Fehlende dazu kommen kann. Aber der Kompass dreht auf diese Frage und so folgen wir dem Impuls.
Meine Partnerin zählt auf, dass schon der Ort, die Zeit und die Menschen für ihr Projekt da sind. Dabei erwähnt sie nebenbei, dass sie ja mit den Menschen auch schon im Innenhof des Seminarortes gearbeitet hat, wenn das Wetter schön war.
Als ich das Gehörte mit meinem Projekt verbinde, fällt es mit wie Schuppen von den Augen: Natürlich, man muss ja nicht immer schon einen wunderbaren und teuren Seminarraum haben. Eine Picknickdecke auf dem Spielplatz reicht auch. Mir fallen die vielen Gelegenheiten ein, wo ich auf einer Decke sitzend mit den Enkeln gespielt habe und wie von selbst haben sich die Freunde und Freundinnen dazugesellt.
Mit fällt immer mehr ein, es braucht keine Ortsvereinbarungen, mühsame Zeitabsprachen. Es braucht mich, meine Ideen und eine Decke auf dem Spielplatz, der Wiese im Freibad …
Ja, da hätte ich von alleine darauf kommen können. Bin ich aber nicht, da hat es den Impuls durch die andere Person gebraucht und den Vorschlag, das in den Blick zu nehmen, was schon da ist.“
Tony: „Sehr interessant. Ich finde, das, was du hier beschreibst, hat weitreichende Implikationen für die Frage, wie stark wir eigentlich in den Prozess eingreifen dürfen. Im personzentrierten Arbeiten ist das ja, strenggenommen, eigentlich gar nicht erlaubt. Mir wird das gerade jetzt, beim Lesen deines Fallbeispiels, erst so richtig bewusst. Ich habe aber das Gefühl, dass es durchaus ok ist, und dein Beispiel zeigt das ja auch, dass es sich hier sehr positiv ausgewirkt hat. Es ist kein richtiges Guiding im Sinne des Focusing, was hier stattfindet. Aber dennoch eine Art von inhaltlicher Lenkung. Ich glaube, das Prozessmodell, das den Hintergrund des Freiraum-Kompasses® darstellt, kann auch lenken. Diesen Aspekt könnte ich mal näher erforschen.“
Bettina: „Für mich ist das kein guiding, sondern aus dem listening auf meine Partnerin kam bei mir eine neue Idee. Es gibt doch die Regel, dass die Hälfte der Zeit für den Begleiter ist. Da wir hier keine Therapie machten, sondern gemeinsames Arbeiten an einem Projekt das Thema war, konnten in meinen 50% eben solche Ideen Gestalt annehmen. Ich habe aus dem gemeinsam geteilten Raum etwas entnommen und weiterverfolgt.“
Tony: „ Hast du noch weitere Erfahrungen gemacht?“
Bettina: „Frau A wählt als Ausgangsproblem ‚Ich lebe fremdbestimmt‘. In einem kurzen Gespräch präzisiert sich das Anliegen, es geht vor allem um den privaten Bereich. Auch hier erlebt sie, dass ständig andere Menschen vorgeben, wann sie was zu tun hat. Als erste Karte wählt sie: ‚Was könnte alles möglich sein?‘ Anfangs fällt es ihr schwer, sich auf die Frage einzulassen, sie erzählt erst längere Zeit, wo und von wem alles über ihre Zeit bestimmt wird. Sie ist geschieden, hat zwei Kinder und einen neuen Lebenspartner, ebenfalls mit Kind. Die Planungen und allen Rollen gerecht zu werden, bringen sie neben einem sehr herausfordernden Beruf an den Rand ihrer Kraft. Ich ermuntere sie immer wieder, im Denken einfach mal ganz groß zu träumen, was ihr aber sehr schwerfällt. Erst als ich mitträume, und phantasiere, beginnt der Prozess. Am Ende steht die Entscheidung, mit den Kindern gemeinsam eine Planung für den Vater-Mutter-Wechsel zu machen und dem Vater der Kinder zukommen zu lassen. Bisher hat er das im Alleingang immer nach seinen Hobbyterminen getan und war sehr unflexibel bei Tauschwünschen. Nun dreht Frau A die Sache um und bringt den Vater der Kinder zu der Erfahrung, dass er um Tausch bitten muss.
Bei weiteren Karten zeigt sich auch, was Frau A. so sehr hindert, sich gegenüber ihrem Exmann durchzusetzen. Hier wäre eine längerfristige Focusing Begleitung hilfreich.“
Tony: „Da steckt für mich auch wieder dieselbe Paradoxie drin. Kann man einen Menschen, der fremdbestimmt lebt, mit von außen kommenden, lenkenden Frageinterventionen so begleiten, dass die Fremdbestimmung weniger wird und die Autonomie stärker? Oder geht das seinem Wesen nach gar nicht? Gut, dass du sie hier durch begleitet hast. Es scheint mir, dass sie auf halbem Wege stecken geblieben ist und dass du als ihre Therapeutin die andere Hälfte übernommen hast.
Kannst du vielleicht auch noch eine Erfahrung schildern, wo der Freiraum-Kompass® gar nicht funktioniert hat? Aus solchen Beispielen kann man meistens sehr viel lernen.“
Bettina: „Eine Kollegin überlegt sich einen Stellenwechsel. Der Wunsch ist es, den inneren Freiraum wiederherzustellen, um klarer auf mögliche Schritte zu kommen. Schon bei der ersten Karte: ‚Mit welcher Situation willst du dich auseinandersetzen?‘ stellt sich die Vielschichtigkeit des Themas heraus. Es kommen sofort die Existenzängste in gleicher Lautstärke wie die Ausweglosigkeit der jetzigen Arbeitsstelle. Schon an diesem Punkt ist mein Eindruck, dass es vorher einen Prozess bräuchte, um eine Teilsituation herauszuarbeiten oder um erstmal Freiraum zu schaffen, sich dem Thema zuzuwenden. Aber noch halten wir am Vorhaben fest, den Freiraumkompass auszuprobieren. Doch jede neue Karte bringt kaum neue Impulse, sondern eher wieder eine neue Umdrehung im Kreis von Ängsten und Verzweiflungsaspekten. Unser Schluss-Resümee ist: Das Unklare an der Anfangsfrage rechnet sich immer wieder in jede einzelne Karte hinein."
Tony: „Das stützt quasi meine These. Du schreibst in dem Beispiel, dass man erstmal vorher Freiraum schaffen müsste, um mit ihm arbeiten zu können. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Mein Gedanke dazu: Zaubern kann der Kompass natürlich auch nicht. Es kommt ganz auf den Einstieg an... ich hätte da vielleicht angeleitet, einfach kurz und knapp und spielerisch zu bleiben und absichtlich schnell und ungenau durchzugehen. So wie du es gemacht hast (langsam und genau, alles gleich maximal öffnen, was angetippt wird) – ich glaube, das funktioniert so nicht, wenn gleich am Anfang schon Strukturgebundenheiten getriggert werden. Sonst passiert genau das: Die Strukturgebundenheit rechnet sich in jede Karte rein.
Einmal mehr kommt es mir so vor, dass das Wesen des Freiraum-Kompasses® die Schnelligkeit und (ja, auch das) gewissermaßen sogar die Oberflächlichkeit ist. Lieber viele Karten schnell durchspielen als jede einzeln tief reinlassen. Dann geht wirklich was vorwärts.
Gibt es ein Fazit für Dich, Bettina?“
Bettina: „Die Menge der Karten und damit der Fragestellungen, die vorgeschlagen sind, kommt mir hoch vor. Ich für mich finde, dass mir ein, zwei oder drei Impulse reichen. Lieber mehr Tiefe als die Breite der Fragen. Aber als erfahrene Focusinganwenderin kann ich mir die Freiheit geben, das Werkzeug so zu nutzen, wie es mir dient.
Der Freiraumkompass gibt bei Selbstfocusing einen Rahmen, innerhalb dessen sich der Prozess entfalten kann. Papier und Stift werden zum Begleiter, damit wird der/die Fragesteller:in unabhängig von einem Menschen, der Zeit und die notwendige Begleitfertigkeit hat.
Beim Begleiten von Prozessen kann der Freiraumkompass als Wegweiser dienen und die jeweilige Fragestellung regt eine prozesshafte Auseinandersetzung mit einem Teilaspekt an.
Bei der Nutzung als Instrument von Klärungsprozessen eines konkreten Vorhabens sehe ich die größte Stärke. Meine Spielfreude wird besonders gefüttert, wenn man es zu mehreren macht und dann das eigene Vorhaben mit den anderen teilt, kreuzt, vernetzt und nicht viel wertet, sondern erst einmal laufen lässt.
Zudem ergibt sich aus dem Gespräch mit dir, dass es sinnvoll sein kann, entweder einen Workshop zum Umgang mit dem Freiraum-Kompass zu besuchen oder einfach, so wie jetzt, mit anderen Anwendern den Austausch zu suchen. Ich habe viel gelernt heute und danke dir für die Zeit, die du mir und den Blog-Leser:Innen geschenkt hast
Tony: „Schön, dann haben wir ganz unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen. Du spielst sehr langsam, ich sehr schnell. Vielleicht ist es eine Typsache.
Ja, und was mir erst durch unseren Austausch klar wurde, ist, dass der Freiraum-Kompass® vielleicht eher sowas sein könnte wie ein Freiraum-Verstärker. Er kann den allerersten kleinen Freiraum, mit dem der Prozess beginnt, selbst nicht schaffen. Es muss schon etwas da sein, womit man beginnen kann. Oder anders gesagt: Er kann den heilsamen zwischenmenschlichen Kontakt nicht ersetzen, den Kontakt, der uns dabei unterstützt, uns innerlich mit uns selbst zu connecten. Wenn das aber da ist, diese erste innere Verbindung, dann potenzieren die Fragen den Prozess, der da beginnt. Vielleicht kann ich diese These noch ein bisschen weiter erforschen. Danke, Bettina, für den schönen Austausch!“
[1] Hofmann, T. (2017): Experienzielle Kommunikation: Wie kann soziales Miteinander in komplexen Situationen gelingen? ZKS-Verlag
Dr. phil. Tony Hofmann, Diplom-Psychologe, geb. 1980, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft am Standort Mannheim (Masterstudiengang Beratung und Leitung im heilpädagogischen und inklusiven Feld), sowie Gründer und Inhaber der Werkstatt für berufliche Profilbildung. Hier unterstützt er seit etwa 20 Jahren Menschen dabei, Websites, Spiele und Tools für und mit Menschen im pädagogischen, therapeutischen und psychosozialen Feld zu entwickeln.
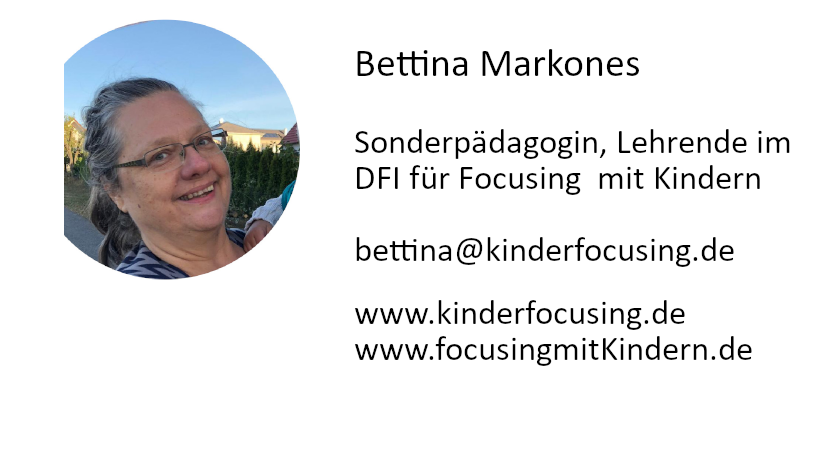





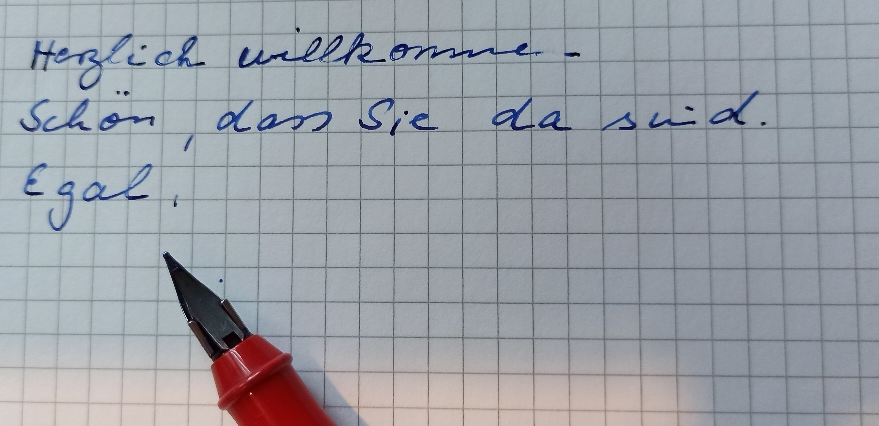





Kommentare powered by CComment