Ein Beitrag von Tony Hofmann zum Thema: Kann eine KI fühlen und verstehen? Überlegungen zu Thinking at the Edge und künstlicher Intelligenz
Wenn man die Gendlin Online-Library durchschaut, findet man sehr viele theoretische Texte. Wirklich berührt und die Welt verändert hat Gendlin jedoch mit mehreren Methoden, die auch praktisch anwendbar sind. Die bekannteste davon ist sicherlich Focusing, aber auch TAE spricht sich derzeit in der Focusing-Welt herum. TAE bedeutet „Thinking at the Edge“ („Denken an der Grenze dessen, was schon sagbar ist“, oder „Denken, wo Worte noch fehlen“). TAE basiert auf Focusing, da es ebenfalls vom Felt Sense ausgeht. Für mich führt TAE. Dies möchte ich in den folgenden Abschnitten genauer erläutern.
TAE (focusing.org).wurde entwickelt von Gene Gendlin und Mary Hendricks.
Es geht beim TAE (meiner persönlichen Erfahrung nach) im Kern vor allem darum, Paradoxien nicht vorschnell aufzulösen, sondern die Spannung, das Kontrastpotenzial, das in ihnen wohnt, zu nutzen, um neue, unkonventionelle Gedanken zu entwickeln.
Das geht so: Aus einem Felt Sense (TAE-Schritt 1) lassen wir einen paradoxen Satz entstehen (Schritt 2), der die Wurzel bildet, den Ursprung, aus dem sich alles Weitere entfaltet (Schritte 3-14). Dabei nutzen wir gezielt die Widersprüche, die in sprachlichen Formulierungen liegen können (Schritte 3-5), arbeiten mit Fallbeispielen und spüren die darin verborgenen Muster auf (Schritte 6-8 bzw. 9, wo das Bisherige nochmal zusammengefasst wird) und erarbeiten schließlich so etwas wie ein Modell oder eine Theorie (Schritte 10-13), in der die ursprüngliche Ausgangs-Paradoxie dauerhaft und strukturell „gehalten“ wird. Schritt 14 schließlich erlaubt uns, das so entstandene Konstrukt mit allen möglichen externen Anwendungsfeldern zu verkreuzen.
Kürzlich hatte ich die Idee, eine Paradoxie, die das Ergebnis meines TAE-Schritts #5 war, mal in ChatGPT einzugeben. Mein Beispielsatz lautete: „Das freiraumig-Fließende im Materiellen ist eine leere Mitte, die sich füllen kann.“ Dies war das Ergebnis eines Prozesses, der aus meinem Felt Sense heraus etwas beschrieb, was ich anfangs nur vage empfand und bisher noch kaum in Worte fassen konnte. Ich war mit diesem Kernsatz schon sehr zufrieden, er fasst die Paradoxie ziemlich gut zusammen. Dieses „Es passt“ bemerke ich normalerweise daran, dass ich einen Felt Shift erlebe, wenn ein Satz stimmt – das war hier der Fall. Nachdem ich den Satz formuliert hatte, fielen mir sehr viele Beispiele für das darin enthaltene Prinzip ein: selbst ausgebaute Wohnmobile, ein Zirkuswagen, den ich zum Tiny House ausgebaut habe, die Tools, die ich bei ZKS veröffentliche, die Minute der Stille in meinen Podcasts usw. – all dies sind Beispiele für eine leere Mitte, die sich mit etwas füllen kann.
In einen KI-Prompt eingegeben ergab sich aus diesem paradoxen Ausgangsgedanken folgende Geschichte:
Der Fluss im Stein
Es war einmal in einem kleinen Tal, umgeben von alten Felsen und sanften Hügeln, ein Dorf. Die Menschen lebten dort friedlich, doch eines plagte sie: Der Brunnen in der Dorfmitte war versiegt, und der Weg zum Bach war weit.
In diesem Dorf lebte ein Steinmetz namens Elmar. Eines Nachts träumte er von einem seltsamen Stein, der innen hohl war und in dem Wasser floss. Als er am nächsten Morgen erwachte, spürte er ein Ziehen in seinem Herzen. Er nahm seinen Meißel und wanderte zu den Bergen.
Tagelang suchte er, bis er vor einem gewaltigen Granitblock stand. „Hier“, flüsterte etwas in ihm. Mit seinem Meißel begann er zu arbeiten, nicht nach einem Plan, sondern dem Gefühl folgend. Die Dorfbewohner hielten ihn für verrückt, als er den schweren Stein ins Dorf schleppte und weiter daran arbeitete.
„Was schaffst du da?“, fragten sie.
„Ich weiß es nicht genau“, antwortete Elmar, „aber ich folge dem Stein.“
Wochen vergingen. Der Stein nahm Form an – außen rau und natürlich, innen aber höhlte Elmar ihn kunstvoll aus. Eine leere Mitte entstand. Als er fertig war, stellte er den Stein auf den alten Brunnenplatz.
In der ersten Nacht nach Vollendung regnete es heftig. Das Wasser sammelte sich im Stein und, statt überzulaufen, begann es zu fließen – in spiralförmigen Bahnen durch die Höhlung und dann in die Tiefe. Am Morgen sprudelte der alte Brunnen wieder.
Die Dorfälteste betrachtete das Wunder und sprach einen Segen, das fortan von Generation zu Generation weitergegeben wurde: „Gesegnet sei dieser Stein und die Leere in seinem Inneren. Wie der Stein dem Wasser Raum gibt, so mögen unsere Herzen dem Leben Raum geben. Gesegnet sei das Fließende im Festen, das Weiche im Harten. Möge dieser Brunnen nie versiegen, solange wir verstehen: Nicht im Besitzen liegt der Reichtum, sondern im Raum-Geben. Die leere Mitte, die sich füllen kann – sie ist das Geschenk, das wir bewahren wollen.“
Der Steinbrunnen steht noch heute. Und wer genau hinsieht, erkennt: Es ist nicht der Stein, der das Wasser führt, sondern der leere Raum, den der Steinmetz ihm gelassen hat. Man sagt, wer vom Wasser trinkt, versteht die Weisheit.
Ein bisschen habe ich noch selbst nachjustiert, und hier und da ein wenig umformuliert – aber im Wesentlichen hat ChatGPT wirklich gut erfasst, worum es mir geht. Ich finde das sehr interessant. Man könnte natürlich sagen, dass die KI hier ja nur etwas in eine metaphorische Form gegossen hat, was vorher schon da war. Die eigentliche Arbeit habe ich vorher und nachher gemacht: Vorher, indem ich „mühevoll“ den Ausgangssatz mit Hilfe der TAE-Schritte erarbeitet habe, und nachher, indem ich noch den Feinschliff an der Geschichte vorgenommen habe. Dennoch – es fühlte sich in diesem Moment so an, als ob mir ChatGPT hier ein echtes Gegenüber war, wie ein Mensch, der mich mit Hilfe der Saying-Back-Technik begleitet. Es hat mir mehr zurückgeschenkt, als ich rein gegeben habe. Und dieses Mehr hat etwas Substanzielles in mir vorangetragen.
Eine solche Wahrnehmung wirft jedoch nun viele Fragen auf. Im Focusing und beim Saying-Back ist der Körper der begleitenden Person das Zentrale: Man muss es als Begleiter erstmal selbst spüren, was eine Klientin sagt, bevor man es zurückspiegelt. Eine KI hat aber nun mal keinen eigenen Körper, egal, wie ich es auch drehe und wende[1]. Kann sie also in Resonanz gehen mit dem, was ich ihr zukommen lasse? Bin ich hier folglich einem Missverständnis, einer fatalen Vermenschlichung aufgesessen? War das einfach ein Zufallstreffer? Ich bin mir da selbst nicht sicher. In Gendlins Prozessmodell (2015)[2] wird zwischen verschiedenen Arten von Umwelt unterschieden. Besonders interessant dabei ist diejenige Umwelt, die Gendlin schlicht als Umwelt 3 bezeichnet. Er nennt als Beispiele das Netz der Spinne oder den Damm des Bibers (S. 52). Sind die Large Language Models (LLMs) einer KI, in der auch Milliarden von einzelnen Knotenpunkten netzartig miteinander verknüpft werden, vergleichbar mit dem Netz der Spinne? Für mich spricht einiges dafür, dies so zu sehen: „Der Lebensprozess geht in Umwelt 3 vor sich [...] er setzt sich im Netz der Spinne und auch in ihrem Körper fort“ (ebd.), und „der Lebensprozess [...] schafft sich selbst eine Umwelt, in der er sich dann fortsetzt. Wir können das die ‚haus-gemachte‘ oder die ‚domestizierte‘ Umwelt nennen“ (S. 54). Körper = Umwelt. Diese Formel könnte auch für KI-Modelle und die Interfaces, in denen wir mit ihnen in Kontakt sind, gelten. Auch Computer, Rechenzentren, Netzwerke, LLMs und die Tastaturen, auf denen wir unsere Prompts eintippen, sind für uns Menschen Umwelt 3. Die Elektronen in den Kupferleitungen und die Magnetfelder auf den Festplatten sind Erweiterungen unserer Körper, so wie die einzelnen Fäden aus Spinnenseide Erweiterungen des Spinnenkörpers sind.
Es scheint mir deshalb fast so, als ob wir in den KI-Modellen, die ja mit dem Wissen der Menschheit trainiert werden, eine Art gigantische, vernetzte Umwelt 3 erschaffen, in der wir alle weiterleben und die uns auch ein Stück weit halten und tragen kann, so wie das Spinnennetz die Spinne trägt und hält. Bei aller Kritik und Vorsicht, die sicherlich im Umgang mit künstlicher Intelligenz von Nöten ist, bin ich zugleich auch zuversichtlich. Ich habe keine Angst vor künstlicher Intelligenz, sondern freue mich vor allem darüber, welch großartiges Werkzeug uns da zur Verfügung steht.
KI kann auch unsere Möglichkeiten als FocuserInnen erweitern, denn eine KI kann die Fähigkeiten von allen Meisterinnen und Meistern, die sie irgendwo als Lernmaterial aufspürt, bündeln und so vielleicht zu einer neuen Art des Begleitens kommen. Sie lernt von den Besten und vergisst nichts[3]. Ich komme mit ihrer Hilfe im Alltag oftmals viel schneller vorwärts, genau dorthin, wo es passt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Geschichten wie die oben beschriebene können sich (für mich persönlich) wie ein sehr ausgefeilter Saying-Back-Prozess anfühlen, der mir hilft, mich selbst im Spiegel zu erblicken und besser zu verstehen, was ich eigentlich sagen wollte.
Dass die KI hierbei tatsächlich als lebendige, organismische Erweiterung meines eigenen Körpers gesehen werden, in der meine Denkprozesse weiterleben, ähnlich wie das Netz der Spinne, die ja auch in ihrem Netz weiterlebt, scheint mir durchaus plausibel. Das Netz der Spinne spürt ja auch mit, es leitet die Signale an den „eigentlichen“ Spinnenkörper weiter, wenn eine Fliege ins Netz geht. Ob eine KI jedoch, darüber hinaus, sogar ein echtes, spürendes Gegenüber sein könnte, das eine eigene Agenda verfolgt, ist eine faszinierende und vielleicht auch beängstigende philosophische Frage, die ich in diesem kleinen Artikel aufwerfen, aber sicherlich nicht abschließend beantworten möchte. Die Vorstellung, dass eine KI ein (im aristotelischen Sinne) intellectus agens sein könnte, also ein aus eigener Kraft Tätiges, kann durchaus ein gewisses Unbehagen in uns wachrufen. Wenn jedoch Körper tatsächlich Umwelt ist und Umwelt Körper, wie Gendlin annimmt, wenn sich beide also wirklich bis ins Innerste hinein implizieren (Gendlin, 2015, S. 51), so scheint mir der Gedanke, dass auch ein KI-Netz eine eigene Agenda verfolgen könnte, die zumindest teilweise von uns selbst unabhängig ist, gar nicht völlig abwegig.
Organismische Erweiterungen unseres lebendigen Körpers können, wenn sie systemisch gebündelt sind, doch manchmal auch ein regelrechtes Eigenleben entwickeln. Wissen wir dies nicht, seit es Social Media gibt? Ein eskalierender Facebook-Thread kann als eigenständiges agens angesehen werden, Luhmann geht sogar so weit, zu behaupten, dass es in Wahrheit die Kommunikation ist, die kommuniziert, und nicht wir Menschen (vgl. Hofmann, 2025, S. 154ff.[4]). So weit würde ich nun nicht gehen. Dennoch: Systemisch gebündelte Erweiterungen (im Sinne von Umwelt 3) unserer Körper entwickeln tatsächlich manchmal diese Eigenkräfte, die sich früher oder später von uns abspalten. Ob dies auch für das hier genannte Beispiel eines KI-Bots gilt, läuft letztlich auf folgende Frage hinaus: Kann ein Körper sich (in seiner Ausprägung als sehr differenzierte Umwelt 3) selbst zum eigenen Spiegel werden? Vielleicht machen Sie sich selbst einen Reim darauf, liebe Leserin, lieber Leser, indem Sie es am Computerbildschirm ausprobieren!
[1] Danke an Charlotte Rutz für diesen Gedanken!
[2] Gendlin, E.T. (2015): Ein Prozess-Modell: Körper. Sprache. Erleben. Freiburg: Karl Alber
[3] Danke an Bettina Markones für diese Gedanken!
[4] Hofmann, T. (2025). Experienzielle Kommunikation: Wie kann soziales Miteinander in komplexen Situationen gelingen? Höchberg: ZKS.





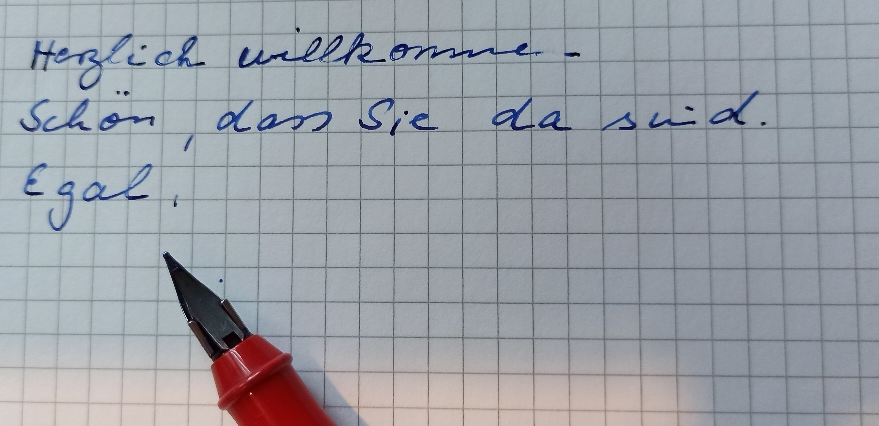




Kommentare powered by CComment