Wie aus meiner Focusing-Erfahrung die Masterarbeit ‚Resonanz in der Supervision‘ wurde
Ein Beitrag von Michael Schneider
Wenn Focusing auf die etablierte Wissenschaft trifft, wird es immer spannend. Warum? Weil das subjektiv-erlebbare-in-der-Welt-sein, wie es im Focusing geschieht, nun objektiv verallgemeinerbar werden soll. Ein körperlicher Zugang, der viele Dimensionen umfasst (das Mehr-als-logische), soll nun allein kognitiv-rational dargestellt werden. Eine herausfordernde Aufgabe.
Diese Aufgabe hatte ich mir aufgehalst, als ich 2022 am Ende meiner Ausbildung als Supervisor stand. Die Ausbildung war das Master-Studium ‚Supervision und Beratung‘ an der Uni Bielefeld.
Ich freue mich, hier nun subjektiv darüber zu berichten. Wie viele andere auch, haben mich die Erlebnisse, die Prozesse, die Erkenntnisse in der Focusing-Ausbildung tief berührt und geprägt. Die Momente, in denen es Klick macht, der Shift, das Vorantragen sind mir wichtig geworden. Ich will seitdem diese Momente ermöglichen und begleiten. Und dies will ich selbstverständlich auch in der Supervision tun.
Ich bin mit der Hoffnung nach Bielefeld gegangen, dort die Perspektive von Gene Gendlin einbringen und verfeinern zu können. Gendlin kannte dort aber niemand und so verbrachte ich viel Zeit damit, ganz andere Theorien zu lesen und zu verstehen und dabei immer auf kleine Hinweise zu scannen, ob denn etwas von Gendlins Erkenntnissen darin zu finden sei. Innerlich war mein Ziel recht schnell, eine Art focusing-orientierte Supervision zu entwickeln und zu betreiben.
So lag es auf der Hand in der Master-Arbeit genau dies zu tun: Finde Theorien aus der Sozialwissenschaft, die mit der Prozess-Philosophie (wirklich) zusammenpassen, ordne diese an und entwickele daraus einen Basis-Ansatz für eine ‚Resonante Supervision‘, wie ich sie seitdem nenne.
Es mussten Theorien sein, die sich mit der Grundidee vereinen ließen, dass zwei Körper oder zwei Wesenheiten zugleich eigenständig sind und sich gegenseitig in Schwingung versetzen können, so wie es bei einem Resonanzphänomen der Fall ist. Gendlin drückt dies bekanntermaßen so aus:
"You and I happening together makes us immediately different than we usually are. [...] How you are when you affect me is already affected by me, and not by me as I usually am, but by me as I occur with you." (Gendlin 1997 #126: 29f.)
Der Soziologie Hartmut Rosa kennt zwar Gendlin nicht, nimmt aber in seinem Buch ‚Resonanz‘ das Bild der schwingenden Körper auf und faltet sie aus. Er übernimmt dazu übrigens eine Definition von Resonanz aus psychotherapeutischer Sicht, welche von Klaus Renn formuliert ist. Rosa untersucht verschiedene Formen resonanter Beziehungen zu Menschen, Dingen und der Welt an sich und auch deren Gegenteil, also verstummte bzw. entfremdete Beziehungen. Gelingt eine resonante Beziehung spricht er von einem Antwortverhältnis. Um mit der beschleunigten und oft entfremdeten Gegenwart zurecht zu kommen, brauchen wir somit resonante , also antwortende Beziehungen zur Welt und zu anderen.
Und damit habe ich für die Supervision bereits eine gute Zielvorgabe für die Begleitung von Menschen in der Arbeitswelt. Dafür zu sorgen, dass antwortende, verstehende Beziehungen zu den anderen im Team entstehen oder erhalten werden. Oder eine Haltung zu einem Klienten zu finden, die mir etwas sagt und die mich handlungsfähig macht.
Mit der Feststellung ‚Das Sprechen über Resonanz braucht eine Theorie über den lebendigen Körper‘ konnte ich nun Gendlins Prozessphilosophie ins Spiel bringen, denn Gendlin hat diese Theorie über den lebendigen Körper im Prozessmodell formuliert wie kein anderer.
Mein Ziel war es, einem inneren Gefühl zu folgen, das mir sagte: Focusing und die Prozessphilosophie müssen in die Supervision hinein kommen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie. Ich spürte aber bereits, dass die interaktionelle Grundlage aus Gendlins Werk, alle anderen Theorien verändern muss, weil sie ein ganz anderes Paradigma erschafft. Wie als würde sich die Tiefenschicht des Bodens verändern und notwendigerweise das, was obendrauf wächst, deutlich beeinflussen. Ich wollte wissen, welche Ansätze auf diesem Boden wachsen und wie sich letztlich dann Supervision für mich und möglicherweise auch für andere stimmig darstellt.
Mit den Begriffen Stopp und Vorantragen konnte ich nun Prozesse des Entfremdens und der Resonanz näher beschreiben und bekam von Gendlin dazu noch eine genaue Herleitung, wie Entwicklung nach einem Stopp passiert. Die Körper-Umwelt-Interaktion rückte als neues Paradigma in den Mittelpunkt. Da ich davon ausgehe, dass die meisten Bloglesenden die Grundbegriffe des Prozessmodells kennen, beschreibe ich sie hier nicht näher. Wie ich das Prozessmodell in diesem Zusammenhang zusammengefasst habe, ist in der Masterarbeit nachzulesen.
Interessanter für die Bloglesenden dürfte sein, was ich denn nun im Bezug auf die Supervision herausgefunden habe.
Aus meiner Sicht hat die Prozessphilosophie als interaktionelle Grundlage in der Supervision unbedingt ihren Platz. Der klassische Focusing-Prozess passt hingegen nur unter bestimmten Bedingungen in die praktische supervisorische Arbeit. Im Einzelsetting kann Focusing eine sehr hilfreiche Ergänzung sein, wenn die supervidierte Person die Voraussetzungen dafür mitbringt. Im Teamsetting ist jedoch oft die Atmosphäre nicht vertrauensvoll genug, dass eine einzelne Person ihre intimen Gefühle und Empfindungen im Beisein aller anderen erforschen kann. Focusing als Selbsthilfe-Methode passt hier oft nicht hin. Wohl aber kann ein focusing-erfahrener Supervisor zwischen den Sitzungen ein Einzelfocusing betreiben und die eigene Interaktion mit der Gruppe oder dem Team erforschen.
Was Gendlins Philosophie im theoretischen Sinne für Konsequenzen hat, sei hier einmal zusammengestellt:
- In jeder Teamsupervision sitzen mehrere lebendige Körper. Jeder dieser Körper hat sein eigenes hochkomplexes inneres Prozessgeschehen aus sich vorantragenden und gestoppten Prozessen. Der gegenwärtige Stand dieses Prozessgeschehens ist als Körper (Erscheinung) und dessen Ausdruck (Sprache, Handeln) wahrnehmbar.
- Jeder Körper ist durch die anderen anwesenden Körper schon leicht verändert (Interaction first). Die durch den Körper aktiv geschehenden Wahrnehmungsprozesse sind mit verändert. Den Anwesenden fallen nur noch bestimmte Dinge ein oder auf, Gedanken sind verändert. Möglichkeiten des gemeinsames Tuns und Sprechens sind in bestimmter Hinsicht eingeschränkt, in anderer Hinsicht gleichzeitig erweitert. Der Teamprozess ist damit ein einziger gemeinsamer Prozess. Dieser Prozess schließt den Supervisor mit ein.
- Ein vom Team oder einer Einzelperson eingebrachtes Problem oder Thema kann als gestoppter Prozess bezeichnet werden. Die Supervision verfolgt das Ziel, vorantragende Faktoren zur Lösung des Problems bzw. zum besseren Verständnis eines Falles zu entdecken.
- Der Körper wird oft vergessen und kann mit Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübungen wieder bewusst werden.
- Die Prozessphilosophie stärkt die Grundannahmen der Humanistischen Psychologie. Die Theorie zur Entfaltung der Persönlichkeit von Rogers, ebenso wie der TZI-Ansatz von Ruth Cohn, das Vier-Ohren-Modell, Gruppenfeld und Gruppenphasen können interaktionell gesehen werden.
- Der Supervisor darf sich als Resonanzkörper in den Dienst des Teams/ der Gruppe/ des Gegenübers stellen. Er darf aufkommende Gefühle als Response zurückgeben und so den Prozess vorantragen. Manchmal kommen Resonanzgefühle erst eine Zeit nach der Sitzung auf (oft sind es drei Tage). Diese kann er erforschen und für den Prozess fruchtbar machen.
- Spiegelphänomene können als eine Art Resonanzphänomen betrachtet werden. Der Stopp des Themas stoppt auch gewisse Teile der Kommunikation. Dies zu bemerken und aufzudecken, kann neue Lösungen erzeugen.
- Plausibel wird auch die Habitus-Theorie von Bourdieu (Herkunft verkörpert sich), die Anerkennungstheorie von Axel Honneth (Anerkennungs-Stopps), das Stufenmodell nach Erikson (Stopps aufgrund von Entwicklungsaufgaben) und der Fähigkeiten-Ansatz von Martha Nussbaum.
- Der systemische Ansatz muss jedoch in seiner theoretischen Grundlegung abgelehnt werden. Die Systemtheorie taugt wenig zur Beschreibung lebendiger Prozesse. Die systemischen Methoden der Aufstellungsarbeit oder der lösungsorientierten Beratung sind hingegen sehr zu begrüßen, solange sie mit Resonanz und den lebendigen Anteilen arbeiten und nicht im kognitiv-rationalen stecken bleiben.
In einem TAE-Prozess habe ich folgende erste Definition für ‚Resonante Supervision‘ entwickelt:
Resonante Supervision ist der Dünger für mehr Eigenständigkeit von Menschen im Arbeitsleben. Sie hat die Körper-Umwelt-Interaktion verlässlich im Blick und arbeitet mit dem Aufspüren von gelingenden und misslingenden Weltbeziehungen (Stopp und Vorantragen).
Insgesamt bin ich froh und zufrieden, mein Gefühl so verwissenschaftlicht zu haben. Einige Theorien haben so ihren Platz in meinem Repertoire gefunden, von anderen konnte ich mich verabschieden. Diese Arbeit ist mein Beitrag zur Entwicklung von focusing-orientierter Supervision und kann perspektivisch dahin führen, eine Theorie oder ein Format in dieser Richtung zu entwerfen.
Die Masterarbeit ist hier zum Download bereit
Ich freue mich über jede Art von Rückmeldung. Gerne nehme ich Anregungen und Initiativen zum gemeinsamen Weiterdenken auf, wie ‚Supervision und Focusing‘ zusammengehen kann.





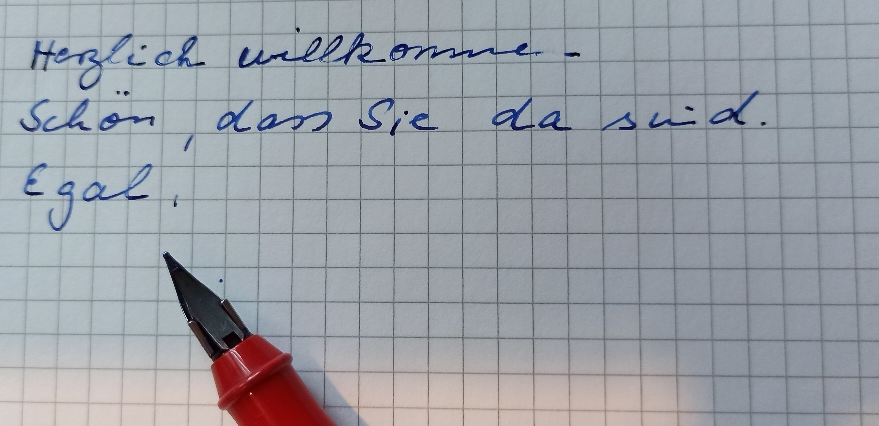





Kommentare powered by CComment