von Bettina Markones
Kreativität
Wenn ich an Kreativität denke, so kommt mir immer das Bild, wie ich aus einem Brunnen in meinem Inneren schöpfe. Mit diesem Bild liege ich sehr nah bei der Definition von Kreativität, die diese als schöpferische Kraft beschreibt.
In der wissenschaftlichen Betrachtung wird unterschieden zwischen Alltagskreativität und außerordentlicher Kreativität. Für mich spielt im Folgenden dieser Unterschied keine Rolle, denn ich will auf das Bild des Brunnens zurückkommen, aus dem der eine Mensch vielleicht Dinge hervorbringt wie eine Kantate von Johann Sebastian Bach und der Andere jeden Tag ein phantasievolles, leckeres Essen mit wenig Geld auf den Tisch zaubert. Es geht mir hier nicht um das Endprodukt, sondern um den Vorgang, den schöpferischen Akt an sich.
Wir müssen heute nur einen Hebel betätigen, dann fließt das Wasser. Aber mein Bild ist ja der Brunnen und das erste, was ich tun muss ist hinzugehen zu dem Brunnen. In meiner Arbeit mit Kindern versuche ich ihnen immer wieder bildlich klarzumachen, wie wichtig es ist, innezuhalten. Dazu wähle ich Beispiele, die dem Alter der Kinder entsprechen. Nehmen wir an, ich habe eine Gruppe Jugendlicher vor mir, mit reichlich Erfahrungen am Computer. Mit ihnen würde ich besprechen, wie es möglich ist, Einstellungen am Handy, Tablet oder PC zu verändern. Dazu muss ich das aktuelle Programm, mit dem ich mich beschäftige, unterbrechen oder gar schließen. Erst dann kann ich in das Menü Einstellungen gehen und Veränderungen vornehmen. Für jüngere Kinder wähle ich andere Beispiele, wie ich es z.B. in meinem Buch „Ich spür Banane blau“ beschrieben habe.
Nehmen wir an, es ist gelungen und der Mensch sitzt nun an seinem Brunnen, bereit daraus zu schöpfen. Aber es fehlt der Eimer, das Seil ist zerrissen oder der Balken, an dem das Seil befestigt war, ist morsch. Wie soll ich etwas schöpfen, wenn schon die Grundvoraussetzungen fehlen. Wenn ich dieses Bild in die Welt des Focusings übertrage, dann habe ich die Idee, dass es hier an dem fehlt, was Eugene Gendlin äußeren Freiraum nennt. Äußerer Freiraum beschreibt, dass um mich herum alles so ist, wie ich es brauche, um mich ungestört einer Sache, einem Thema, zuwenden zu können. Hunger, Durst, Kälte, Müdigkeit und andere Faktoren können hier hineinspielen. Auch Lärm und ungünstige Lichtverhältnisse sind für viele Menschen etwas, das den äußeren Freiraum nimmt.
Wenn wir zu meinem Bild zurückgehen, dann ist nach dem Herstellen des Äußeren Freiraumes die Situation so, dass wir loslegen könnten mit dem Schöpfen. Aber es geht nicht los mit kreativen Gedanken, sondern mit einem alten Schuh, den ich heraushole, einer leeren Flasche und einem Plastikbehälter. Im Inneren Erlebensraum eines Menschen ist oft erstmal viel, was den Inneren Freiraum nimmt. Dieser geht immer dann verloren, wenn Themen zu gewaltig, zu nah, zu bedrohlich usw sind, so dass es nicht mehr möglich ist, einen guten Abstand zu ihnen zu finden. Leistungsdruck, Notendruck, Zeitdruck, Angst oder persönliche Probleme können verhindern, dass ich inneren Freiraum habe.
Hier setzt im Focusing das sogenannte Freiraum schaffen an. Wir holen den alten Schuh hoch, nehmen wahr, dass er da ist und beschließen, ihn in den Restmüll zu geben. Dann kommt die leere Flasche und wir bringen sie zum Altglas, den leeren Plastikbehälter geben wir in die gelbe Tonne oder was eben vor Ort dafür zur Verfügung steht. Nehmen wir an, der alte Schuh steht für einen Streit, der mich bedrückt. Ich nehme alles, was zu dem Thema gehört und lass es zu einem Etwas werden, das einen guten Platz bekommt. Durch diesen Schritt schaffen wir eine Distanz zu dem Thema und sind nicht mehr völlig verstrickt.
Mit den Kindern tue ich das sehr gerne praktisch. Ein Kind erzählt mir von einem Streit, der es sehr belastet. Als Symbol für den Streit nimmt es einen Gegenstand, der ihm passend erscheint, einen Stein, einen Klotz oder einen gemalten Schuh. Dann suchen wir: wohin damit, dass das ganze Thema erst einmal etwas Abstand zu mir hat. Das Kind bemerkt: für diese Stunde will ich den Streit erstmal nicht ansehen und legt das Symbol z.B. vor die Türe. Damit ist noch keine Lösung da, aber das Thema ist an einem guten Ort und daneben kann auch noch etwas anderes bemerkt werden. Denn wir sind immer mehr als unsere Themen.
Gehen wir zurück zum Bild des Brunnens: nun ist der Weg zum Wasser frei, wir können schöpfen. Aber halt, da gibt’s noch etwas: sitze ich alleine am Brunnen, nur für mich und frei von unausgesprochenen Erwartungen oder hockt, sichtbar oder unsichtbar, noch jemand dabei? Ist es jemand, der mich ermutigt, unterstützt, begleitet und auf einen guten Abstand zu mir achtet? Oder ist da imaginär jemand da, der Angst, Bewertung, Kritik oder Entmutigung mit zum Brunnenrand bringt? Im Focusing wird das als Beziehungsfreiraum bezeichnet, der immer Vorrang hat. So muss ich den sichtbaren oder unsichtbaren Begleiter, der solche Gefühle weckt, zumindest innerlich so weit wegschicken, dass niemand mehr mit dasitzt, der mir diesen Freiraum nimmt. Oder es braucht einen anderen Schritt, wie eine Klärung der Erwartungen ect.
Und nun, endlich kann ich schöpfen, in mich hineinhorchen, spüren und abwarten. Ich nehme meinen Eimer und lasse ihn hinunter. Der Eimer ist das Sinnbild für meine Suche, will ich ein Bild malen, ein feines Essen aus Resten zaubern oder eine Lösung für ein Problem finden. Was immer es ist, ich lasse den Eimer in die Tiefe, meine eigene Tiefe, den Spürraum meines Körpers. Vielleicht dauert es ein bisschen, aber irgendein Vages, noch nicht Sprachliches entsteht in mir. Dann zeigt sich ein winziger Fetzen, die Hand greift zu einer Farbe, die Zutaten fangen an sich vor meinem inneren Auge zu sortieren oder mir fällt ein, dass ich irgendwo ein Werkzeug (auch gerne im übertragenen Sinn) habe, mit dem ich mein Problem lösen kann. Diesen kleinen Zipfel erhasche ich und ziehe ihn hoch.
Der Rest geschieht, denn ein begonnener Prozess des Fühlens, Spürens und Denkens setzt sich fort. Was ich brauche ist das „Dabei bleiben“ und Tun, vielleicht auch die Möglichkeit, mir Unterstützung zu holen. Denn ich erlebe immer wieder, dass Kinder zwar eine hoch kreative Idee haben, es aber am „know how“ zur Durchführung scheitert.
Als ich die Bücher von Rebeka und Mauricio Wild gelesen habe, träumte ich lange Zeit davon, so lehren zu können. Ich hätte gerne einen Schneiderpavillion gehabt, in dem die Kinder ihre Ideen umsetzen und ich ihnen helfe, wenn es Schwierigkeiten gibt. In einem Schulprojekt habe ich diesen Traum für eine Woche leben können. Mit 10 Kindern machte ich ein Upcycling-Projekt, bei dem wir aus gespendeten alten Kleidungsstücken neues schneiderten. Nachdem ich eine grundlegende Einführung in das Nähen mit der Maschine gegeben hatte, legten die Kinder los. Den Rest der Woche war ich hauptsächlich damit beschäftigt, bei Problemen mit den Nähmaschinen zu helfen und spezielle Techniken wie Kopflöcher zu machen, zu zeigen. Die Kreativität der Kinder war so beeindruckend und die Modenschau am Ende der Woche einfach großartig.
Als Kriegsenkelin bin ich sehr zur Sparsamkeit erzogen worden und musste mühsam lernen, dass zu große Sorge vor Verschwendung im Umgang mit Materialien die Kreativität ausbremst. Eine Entlastungsmöglichkeit für mich habe ich schon vor sehr langer Zeit in der Verwendung von Abfall- oder Naturmaterialien gefunden. Bei uns in der Familie wurde so oft beim Essen von Joghurt gelästert: „Du brauchst den Becher doch bestimmt für ein Projekt oder soll ich ihn vielleicht ausnahmsweise wegwerfen.“ Das liegt über 25 Jahre zurück und heute wäre ich voll im Trend mit meinen Ideen für Upcycling. Meine Enkelin hat sich auch schon angewöhnt, Verpackungen anzusehen und zu überlegen, ob sie damit etwas basteln könne. Derzeit sammeln wir Tetrapacks um sie zu Vogelfutterstationen umzubauen. 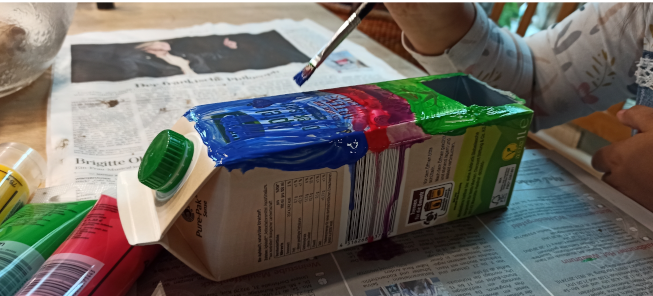
Was mir noch geholfen hat im Umgang mit der kreativen Arbeit von Kindern ist ein Satz, den ich mir oft innerlich sage: „Materialerfahrung geht vor Endprodukten.“ Auch das hilft mir, bei dem Gematsche mit Farben, Ton oder anderen Materialien gelassen zu bleiben. Das ist gut so, denn ich will nicht als heimliche Störung am Brunnen der Kreativität sitzen, sondern eher als interessierter Begleiter. So konnte ich auch meiner Enkelin mitgeben, dass sie sich nicht in erster Linie um das Endprodukt Gedanken machen muss. Wenn sie mal wieder irgendwie Materialerkundungen betrieben hat und jemand kommt und sie fragt, was das sein soll, sagt sie ganz klar: „Das ist Kunst“ und lässt sich auf keine weitere Diskussion ein.
Am Ende möchte ich noch etwas zu der sehr unpopulären Langeweile schreiben, die die Kinder hassen und auch viele Erwachsene nicht gut aushalten. Langeweile ist aber der beste Weg, schnell etwas aus dem Brunnen zu bekommen. Die Langeweile aushalten, bis mir die Idee kommt, mich meinem Brunnen zuzuwenden, darum geht es. In unserem Haushalt begrüßen wir die Langeweile der Kinder und versuchen, uns nicht auf die Rutschpartie der guten Vorschläge zu begeben. Im ersten Moment ärgern sich die Kinder oft über diese Haltung, aber Langeweile hilft, Gedanken zu sortieren, und allmählich wieder in Kontakt mit sich und der eigenen Kreativität zu kommen. Das sollten wir ihnen doch nicht wegnehmen.
„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen.“ Pippi Langstrumpf/Astrid Lindgren
Dieses einfach nur schauen, ist eine der Quellen, die den Brunnen füllen. Mögen Sie nicht auch gleich mal ein bisschen dasitzen und vor sich hinschauen?
Zuerst erschienen in der Zeitschrift "Die Freilerner"
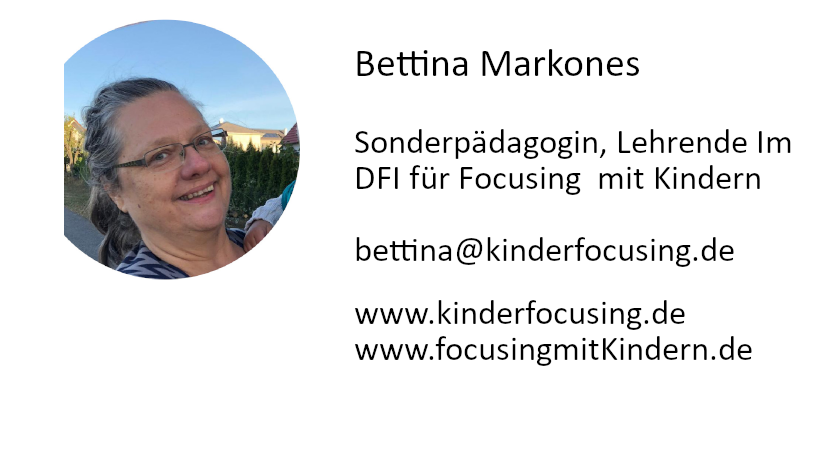




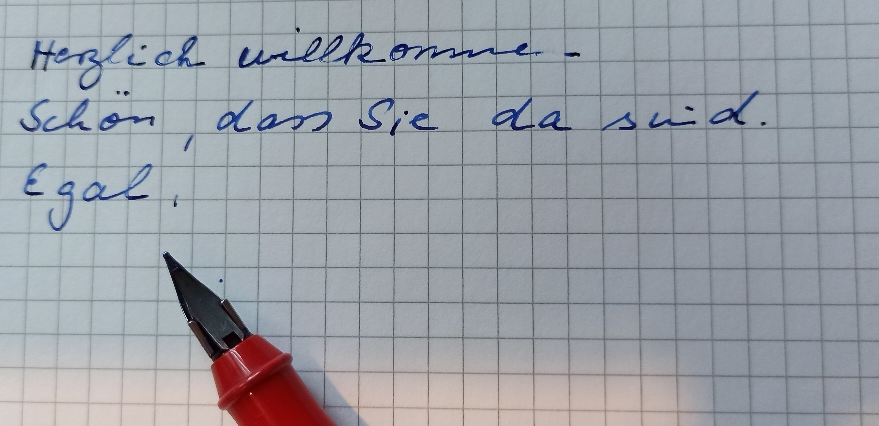





Kommentare powered by CComment